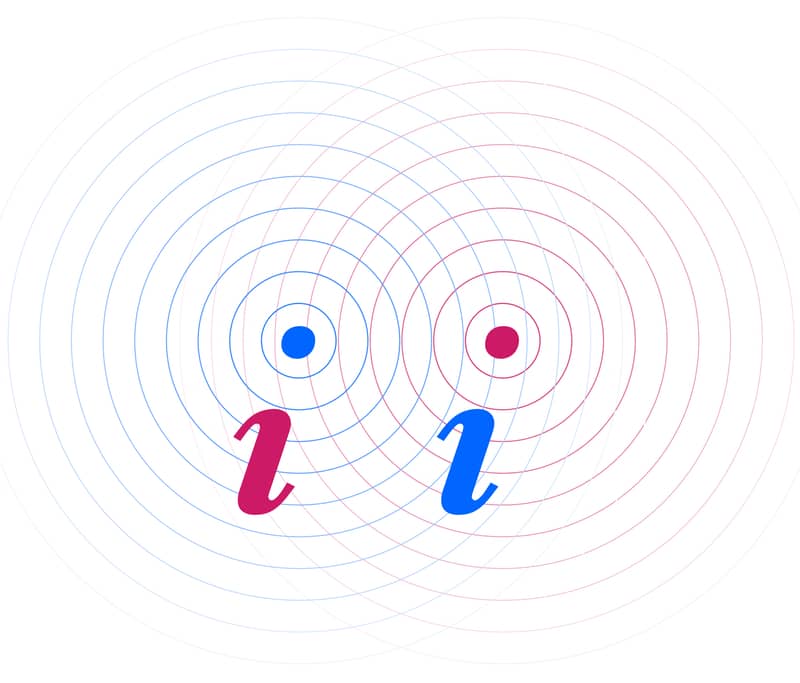30. Jänner 2016. Angekommen. Und irritiert. Erst eine Wärmebildkamera, die den ankommenden Touristenschwarm auf Zirka-Viren scannt. Eine Masse an grünen Gesichtern auf dem Bildschirm beim Verlassen des Gate. Mutet wie eine Marsmännchen-Invasion an, futuristisch und befremdlich. Aber das ist Singapur. Wer ein rotes Gesicht hat, wird vermutlich sofort aussortiert und muss vor Ort einen Virentest und Temperaturkontrolle machen. Die Ärzte dafür stehen bereit. Nichts größer als die Sorge des Inselstaates, dass sich Seuchen verbreiten und das Image von der „Schweiz des Ostens“ beschädigt wird.

Dann erst das erwartete, bezaubernde strahlende und herzliche Lächeln der Empfangsdame am Changi Airport in Singapur, die eingehüllt ist in ihren bunten Sari in den Farben der nationalen Airline jeden Gast mit einem warmen „welcome to Singapore“ begrüßt. Die Einreise wie immer in ein paar Minuten erledigt. Da hat sich nichts verändert. Auch nicht an der langen Warteschlange vor dem Taxistand, schön aufgefädelt in einer Reihe, wie die Briten das zur Kolonialzeit gelehrt haben. Drängeln gibt es hier nicht, vordrängen sowieso nicht.
Dann die nächsten Kameras am Weg in die City. Auch Schnellfahren ist hier nicht angesagt und kostet, wie alle Verbote, die missachtet werden, eine horrende Summe an Geld. Deshalb funktioniert hier seit Jahrzehnten alles wie am Schnürchen. Und wenn man weiß, dass mittlerweile mehr als 4,5 Millionen Menschen unterschiedlichster Herkunft auf einem Flecken wie Berlin leben, dann versteht man auch die Notwendigkeit von strengen Regeln für gutes Zusammenleben. Geplant sind bis zu sechs Millionen Menschen, die die Regierung sukzessive ansiedeln will. Das erzählt die Taifahrerin am Rückweg zum Flughafen ein paar Tage später. Eine einheimische Muslimin, die eine der wenigen Frauen ist, die hier in die Männerzunft der Taifahrer eingedrungen ist. Fahren darf nur, wer Staatsbürger von Singapur ist, erzählt sie mit Stolz. Und Autofahren kann sie auch, die kleine, zierliche Frau, die mit ihrem Kopftuch fast hinter dem großen Lenkrad verschwindet. Skepsis ist hier unbegründet und ein nettes Gespräch inklusive.
Das Immigrationsprogramm macht nicht alle glücklich, erzählt sie. Der Autoverkehr wird immer mehr und mittlerweile schafft man es auch hier Stunden im Stau zu verbringen bei den mehr als einer Million angemeldeter Autos und wieder einer zunehmenden Zahl an Motorrädern. Die gab es vor ein paar Jahren hier nicht. Man kommt damit aber leichter durch die verstopften Straßen. Da aber auch in Singapur immer weniger Kinder zu Welt kommen und die demografische Entwicklung sich der in der westlichen Welt annähert wird der Überalterung der Gesellschaft massiv entgegengearbeitet. Gesteuerte Immigration heißt dabei ein Zauberwort.

Bei der Landung in Medan keine Kameras, rundherum nur strahlendes Lächeln und freundliche Willkommensgrüße, die das Gefühl vermitteln, hier als Europäer, und davon gibt es in Medan nicht viele, wirklich willkommen zu sein. Bis Lombok und Bali werden uns nur sehr wenige „Weiße“, dafür umso liebenswertere Indonesier begegnen, die nichts lieber machen, als sich mit den Menschen aus dem fernen Land – very far away? ist eine Standardfrage – fotografieren zu lassen. Heute im Zeitalter des Smartphones ja kein Problem mehr. Die Hotels sind hier fest in indonesischer und chinesischer Hand. Heißt: allerhöchste Aufmerksamkeit und bestes Service für die Europäer. Im Stammhotel in Medan werden die beiden Weißen bereits liebevoll mit Vornamen angesprochen. Der dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben, da sogar der Concierge beim Ausleihen des Regenschirmes weiß, dass das Miss Edith ist. In den frühen Morgenstunden wehen die melodischen Stimmen der Muezzins der vielen Moscheen der zwei Millionen Stadt durch die leeren Straßen von Medan und können – zum Glück – auch von den schalldichten Fenstern der Fünfsternehotels nicht abgehalten werden. Schönes Aufwachen und ein Traumblick beim Sonnenaufgang aus dem 23. Stock über die Dächer der Stadt. Schräg gegenüber dem Hotel eine katholische Kirche, die die Christen zum Morgengebet einlädt.
In der Lion Air von Medan nach Padang in Westsumatra gipfelt das perfekte Service darin, dass die Europäer wegen der „Übergröße“ einen Exit-Platz mit freiem Fußraum angeboten bekommen. Zur Ehrenrettung sei hier angemerkt: oversize gilt hier ab 161 cm und Kleidergröße 36 L. Hilfe wird überall angeboten, man muss nur irgendwo in der Gegend rumstehen und etwas ratlos schauen. Schon stehen zwei, drei Indonesier bereit, die, auch wenn es keine gemeinsame Sprache gibt, da auf Sumatra außerhalb der Städte nur wenige Englisch sprechen, gerne weiter helfen. Die 1000 Stufen in die Tiefen des Sianok Canyons beispielsweise nahe Bukingttinggi findet man nie, wenn nicht eine hilfreiche Indonesierin, die um die Mittagszeit ihr Kind von der Schule abholt, anbietet, ein Stück mit dem Motorrad vorauszufahren. Der Canyon ist dann, so wie vermutet, mit dem Grand Canyon in den Vereinigten Staaten nicht vergleichbar, aber wer diesen noch nicht gesehen hat, ist durchaus beeindruckt von den Steilwänden und dem Lavabett, das sich vor rund 200 Jahren beim Ausbruch des nahe gelegenen Merpati seinen Weg in die Tiefen des Sandsteins gegraben hat. Heute wird dieses aktuell ausgebaut für touristische Zwecke zum Wandern und Rafting. Die Vulkane in der Gegend sind immer noch aktiv und eine Touristenattraktion in dieser wunderschönen und üppigen Landschaft an der Matawai Strait am Indischen Ozean u d laden zu Tageswanderungen und mehrtägigen Besteigungen ein.

In Bukingttinggi, in den Bergen Westsumatras, lebt heute noch eine der letzten matriarchalischen Kulturen der Welt. Die rund 3 Millionen Minangkabaus sind orthodoxe Muslime, die aber auch Ahnenkult betreiben und dem Adat – Rechtskodex – der Clans folgen. Es gilt das weibliche Erbrecht, das Stadtbild ist von Frauen geprägt, die hier in der islamischen Welt den Ton angeben. Frauen in bunten bodenlangen Kleidern mit Kopftüchern neben jenen mit modernem Haarstyling, engen Jeans und T-Shirt. Sehr oft auch kombiniert. Sie scheinen – optisch zumindest – in der Mehrheit zu sein, auf den Straßen und Märkten während des Tages und auch nächtens in den Bars, in denen bei Live-Musik Party gemacht wird. Ähnlich wie bei den Batak auf Samosir sind auch die indonesischen Minangkabau-Jungs äußerst musikalisch veranlagt und machen tolle Musik. Zum Teil noch ohne großen Aufwand, mit der Gitarre und ohne Verstärker. Und wie überall auf der Welt freuen sie sich über begeisterte Zuhörer und auch die vielen einheimischen Zuhörerinnen.
Der nahegelegene Danau Minajau ist wie der Lake Toba ein Kratersee, der heute touristisch genutzt wird und zu Festtagen, wie dem Chinesischen Neujahrsfest, stark frequentiert ist. Faszinierend die tiefgrünen Reisfelder, die ohne Grenzen in den See hineinwachsen. Gefeiert wird auch in Indonesien alles, was es zum Feiern gibt. Christliches Weihnachten genauso, wie islamisches Fastenfest und Bairam, Silvester wie Chinesisches Neujahr. Im Unterschied zu vielen westlichen Ländern wird hier alles sehr sichtbar und „offiziell“ gefeiert, so begrüßen auf den Flughäfen zu Weihnachten der Weihnachtsmann und schön geschmückte Christbäume begleitet von Weihnachtsmusik, zu Chinesisch Neujahr in diesem Jahr der Affe und chinesische Volksklänge. Zwischendrin verschafft sich der Muezzin Gehör, wenn er um die Mittagsstunde die gläubigen Muslimen zum Gebet ruft. Überall, an den Stränden ebenso wie auf den Flughäfen und den Märkten der Orte. Das Sprichwort „Man soll die Feste feiern wie sie fallen“ wird hier wörtlich genommen, in Singapur beispielsweise ist man auch bei allen Festlichkeiten bemüht, immer alle Konfessionen einzubinden. Ein Zeichen des Respekt und der Wertschätzung allen Bevölkerungsgruppen gegenüber. Seit Jahrzehnten wird dort – am Rande bemerkt – auch in aller Selbstverständlichkeit in den Restaurants, Food-Stalls und den öffentlichen Schulen und Universitäten das Geschirr beim Abwasch getrennt –in Halal dishes und nicht Halal dishes.
Das Chinesische Neujahrsfest in Medan ist bunt und laut. So wie es sich für Chinesen gehört. Natürlich auch mit Feuerwerk. Der traditionelle Lions-Dance soll allen, die dabei sind, Glück bringen. Eine Portion extra davon gibt es für diejenigen, denen es gelingt, den Löwen zu berühren. Das Essen des chinesischen Chef-Kochs, der gerade im Marriott Hotel mehrere Wochen gastiert ist eine Klasse für sich. Nach so einem Dinner geht man in Europa nicht mehr gerne zum Chinesen. Der Stamm-Chinese in der Nähe des eigenen Heimatortes natürlich ausgenommen. Das chinesische Neujahr beginnt am 9. November 2016. Es steht im Zeichen des Affen und soll laut Vorhersagen ein bewegtes Jahr werden – mit Veränderungen, geistiger und körperlicher Bewegung. Mal sehen. Um es gut zu beginnen, darf jeder für wohltätige Zwecke spenden, und damit man den Affen ein ganzes Jahr lang bei sich hat, gibt es auch überall T-Shirts mit Affen zu kaufen. Rot natürlich, die chinesische Glücksfarbe, in der auch alle zum Fest erscheinen.

Um das Jahr auch standesgemäß zu beginnen, scheint ein kurzer Abstecher in den Urwald mehr als passend. Es hat zwar die letzten Tage viel geregnet und angeblich steht im Urwald alles unter Wasser, aber nachschauen schadet ja nichts. In der Nähe von Medan, gute 80 Kilometer und vier Stunden Fahrzeit entfernt, in Bukit Lawang, wohnen im Leuser Nationalpark noch rund 6000 der letzten Waldmenschen der Welt – die Orang Utans. Sie sind mit jenen auf Borneo die letzten ihrer Spezies, haben auf Sumatra aber wesentlich rötlicheres Fell und schauen jenen, die in Europa als Stofftiere zu kaufen sind, viel ähnlicher als die Borneo-Orang Utans. Der Großteil dieser faszinierenden Tiere wurde auch auf der indonesischen Insel Sumatra von Menschenhand ausgerottet. Durch Abschuss, Gefangenschaft oder Waldbrandrodung der großen Palmölimperien, die, so wie in Malaysia, auch in Indonesien noch Gang und Gäbe ist, obwohl immer mehr Naturschutzprogramme gestartet werden, um die letzten Reste des Millionen Jahre alten Urwaldbestandes zu retten. Im Leuser Nationalpark, der UNESCO Weltnaturerbe ist, hat der WWF bis vor kurzem ein Rehabilitationsprogramm umgesetzt. Seit der Überflutung der Gegend Mitte Jänner 2016 sind die Brücke über den Bohorok-River und der Eingang zum Park und zur Fütterungsstation in Bukit Lawang geschlossen. Die Urwaldtour kann aber mit lokalen Führern gebucht werden.

Erwin, der das schon seit mehr als 15 Jahren macht, weiß auch einen Platz, an dem man in freier Wildbahn Orang Utans findet. Gegen 10 Uhr lässt sich der erste hoch oben in den Baumwipfeln sehen. Wenig später kommt eine Mutter mit einem gut zweijährigen Jungen. Da sie als Baby bei Menschen aufgewachsen ist, darf man ihr bis auf gute 8 Meter nahe kommen. Dann ist aber Schluss mit lustig und sie geht auf Angriff über, um ihr zweijähriges Baby zu verteidigen. Mit genügend Abstand kann man ihr aber in Ruhe beim Fressen und Füttern zuschauen wieder mal feststellen, dass es durchaus vergleichbare Verhaltensweisen mit den Orangs, den Menschen gibt.

Auch die Thomas Head Monkeys, die ihren Namen von der Mokassin Frisur haben und die es nur auf Sumatra gibt, sind sehr neugierig und lassen die Menschen, wenn sie sich entsprechend ruhig verhalten, sehr nahe kommen.

In den Abendstunden bereiten die Frauen des Dorfes in den schönen Homestays herrlich, frische – und wenn man es extra bestellt – auch scharfe Curries zu und die Männer greife zur Gitarre und singen mit den Touristen heimische und internationale Lieder, darunter auch der ein oder andere Abba Song. Ihre gute Laune haben die Menschen in Bukit Lawang erst die letzten Jahre zurück erobert. 2003 hatte eine 20 Meter hohe Springflut den Ort quasi innerhalb weniger Minuten ausgelöscht, 200 Tote und ein völlig zerstörtes Dorf waren zu beklagen gewesen. Es hat einige Jahre gedauert, bis sich die traumatisierte Bevölkerung von dieser Katastrophe erholt hatte, dann aber wurde gemeinsam zugepackt – wie das in ganz Asien immer noch üblich ist – und gemeinsam haben sie das Dorf und eine gute Infrastruktur für nachhaltigen Tourismus wieder aufgebaut. Der Ort und die Homestays sind nur zu Fuß zu erreichen, die Wege sauber gepflastert mit Flusssteinen die einfachen Häuser liebevoll eingerichtet mit Teakholzmöbeln und schönen Gartenanlagen, die an mediterrane Gegenden erinnern.
Wenn man den jungen Männern zuschaut, wie sie immer noch zwölf Stunden am Tag die Steine aus dem Fluss sammeln und diese in schweißtreibender und mühevoller Arbeit zu den Häusern hochbringen, über schlammigen Böden und rutschige Stufen, dann bekommt man einen Eindruck davon, was hier „gemeinsam etwas schaffen“ heißt. Dabei haben sie auch immer noch ein freundliches Lächeln und ein herzliches Hallo für die vorbeiwandernden Touristen parat. Ein rundherum freundliches, mit Ausnahme einiger fundamentalistischer Zentren in Banda Aceh, sehr friedliches, sympathisches Land.